Barack-Nummer: 90
|
|
 Tiff-Version
Tiff-Version
|
|---|
| Überarbeiteter Text |
|---|
|
90.
(Jetzt
Karlsruhe, BLB, Don. 90)
Papierhandschrift
des XV. Jahrh. (1452), 202 Blätter in 2°. Holzdeckel mit rothem
Schaaflederüberzug.
1.
Das Heldenbuch, und zwar:
a.
Bl. 1—25:
König
Otnit.
Die
ersten Blätter sind verloren. Das erste vorhandene beginnt:
Das
ist im wol geratten er hat sie kainen mût
Vnd
wil och dich beschaiden war vmb er das tut Er hat im für gesetzt das mag er
sich wol Schemen Wan die mutter gestirbet die dochter wolle er
nemen.
Schluss :
Nun
lassen wir beliben die wurme fraischlich Vnd kurtzen wir die wille mit hugen
dietrich Er wuchs in kosten opel mit hohen eren hie Der in sine jungent cluge
auenture begien.
b.
Bl.
26—148a:
Hie
uahet wolff dietriches buch an.
Eingang
:
HIe
mügent ir gerne hoeren singen vnd sagen Von clüger auenture so mussent
ir betagen Es ward ain buch funden das sag ich vch für war Zu bagemünt
in dem closter lag es vil manig jar Es ward gefunden in baier land Dem byschoff
uon ainstetten ward es bekand Er kürtzet im die wille dar abe wol
sybentzehen jar Do fand er auenture das sag ich vch für war Do er das buch
vber las an den arm er es nam Er trug es in das closter für die frowen
wolgetun (—tan) Dar zu hat (Das zu sant) waltburg zu ainstetten stat
Merckent uon dem gutten buch wie es sich so wit
zerspraittet
hat
Schluss
:
Also
was er im dem closter dannoch sechszehen jar Er diente got mit flisse seyt vns
dis buch fürwar Die engel an sinem ende fürte sin sele uon dan Da mit
hat dis buch ain ende also mus es vns
och
ergan.
Genauer
betrachtet enthält dieser 2. Theil, trotz der Ueber-schrift “Hie
vahet wolff dietriches buch an" zuerst die Geschichte von Hugdietrich, welche
bis Blatt 43 geht, worauf mit der Ueberschrift: “Wie das huge dietrich
starb vnd wie boge vnd wachsmut wolffen dietrichen iren bruder uon dem lant
wolten stossen vnd sprachen wie er ain banckert were vnd das er dar vmb nit
erbes moechte
besitzen" —
erst der Wolfdietrich mit der Strophe
:
Nun
lassen wir beliben den edelen kaiser rich Vnd kurtzen wir die wile mit wolff
her diettrich Er wuchs in grosen eren bis er ward zu ainem man Do sin lieber
uatter starb do ward sin froede zergan beginnt.
Die
Handschrift gehört zu den im XV. Jahrhunderte vielfach verbreiteten und
beliebten Sammelhandschriften der deutschen Heldensage, deren in v. der Hagen
und Büsching's Grundriss S. l—23 und Goedeke, Grundriss §.61
eine grosse Anzahl aufgeführt werden. Der Text stimmt mit dem alten Drucke
des Heldenbuchs überein.
Vgl.
v. der Hagen und Primisser's Heldenbuch, Berlin 1820—25. Heldenbuch.
Altdeutsche Heldenlieder aus dem Sagenkreise Dietrichs von Bern und der
Nibelungen durch Fr. H. v. der Hagen. Leipzig 1855; W. Grimm, deutsche
Heldensage § 58.
Einzeln
herausgegeben wurde der Ortnit von Mone 1821 und nach älterem Texte :
Künec Ortnides mervart unde tot, von Ettmüller, Zürich 1838;
Hugdietrichs Brautfahrt und Hochzeit nach einer Oehringer Handschrift von F.
Oechsle, Stuttgart 1834; s. ferner Haupt, Zeitschrift IV, 401 ff.
Eine
Ausgabe des Wolfdietrich, zu der auch diese Handschrift benützt wurde, wird
von Holtzmann vorbereitet.
Vgl.
auch Zarncke in Pfeiffer's Germania I, 53 ff.
2.
Bl.
148b—202a
:
Hie
hebet an der suben maister buch.
Anfang
(die Verse sind fortlaufend geschrieben):
Aller
diser weit her kayser vnd got
wie
haiig sind alle ding (1. din gebot)
wie
grosz vnd starck ist din gewalt
Din
gütte vnd milte ist manigfalt
Grundlose
ist din barmhertzikait
vnzallich
ist din wisshait Schluss :
Do
starb der kayser pünccion
vnd
rieht sin sun dyoclecion
Nauch
sinem vatter manig jare
Das
sin maister er für war
er
hett by im lange zit
Die
in lertend getrulich vor vnd syd
Doch
er wise vnd rich ward
vnd
warend so uff in gekart
Das
sy hettet zu aller not
Für
in gegangen in den tot
Des
warend sy behende
Bis
an irs lebens ende
Hye
endet sich das gedichte
Der
syben maister geschichte etc. etc. Hie haut dis buch ain ende Gott vns uon
Sünden wende. Anno domini M° CCC. lii°. jar. Auf dem letzten
Blatt:
Item
Ludwig Messerschmid der Jung zu Wissen-
staig
hat dis buch usz gelessen vff pfingstenn Anno
Domini
m cccc lxxx jaur.
Item
enderis bürer der jung hat das buch vsz
gelessen
vff letare anno domini M° CCCC
lxxxi
jaür.
— Der letztere fügte noch
bei:
0
mutter aller gnaden rich Ich bitt dich vmm hilf gar fliszlich Das du mir der
beholffen wellest sin Das bit ich dich himel kaiserin.
Der
Verfasser dieser poetischen Behandlung der vielberühmten
volkstümlichen Fabel von den 7 Meistern ist nicht genannt. Er sagt von sich
im Eingang, dass er sein Werk aus dem lateinischen übertrage, nennt sich
jedoch “der geschrifft layder ain kind."
Die
Handschrift schliesst sich an die Erlangen'sche an, welche Ad. Keller in den
altdeutschen Gedichten, Tübingen 1846, S. 15 ff. herausgab.
Eine
andere gereimte Bearbeitung des gleichen Stoffes ward bekanntlich von Hans dem
Büheler, einem Hofbeamten des Erzbischofs Friedrich von Cöln, im Jahr
1412 verfasst. Sie ist dem Inhalte nach gleich, in der poetischen Behandlung
aber, da Hans von Bühel freier und gewandter zu erzählen weiss,
wesentlich von der vorliegenden verschieden. Beide Bearbeiter scheinen
unabhängig von einander aus derselben Originalquelle geschöpft zu
haben.
Vgl.
Dyocletianus Leben von Hans von Bühel. Herausgegeben von Adelb. Keller.
Quedlinburg 1841, und über das Volksbuch der sieben Meister überhaupt
die Einleitung zu Li romans des sept sages, herausgegeben von Heinr. Adelb.
Keller. Tübingen 1836.
|
| Originaltext |
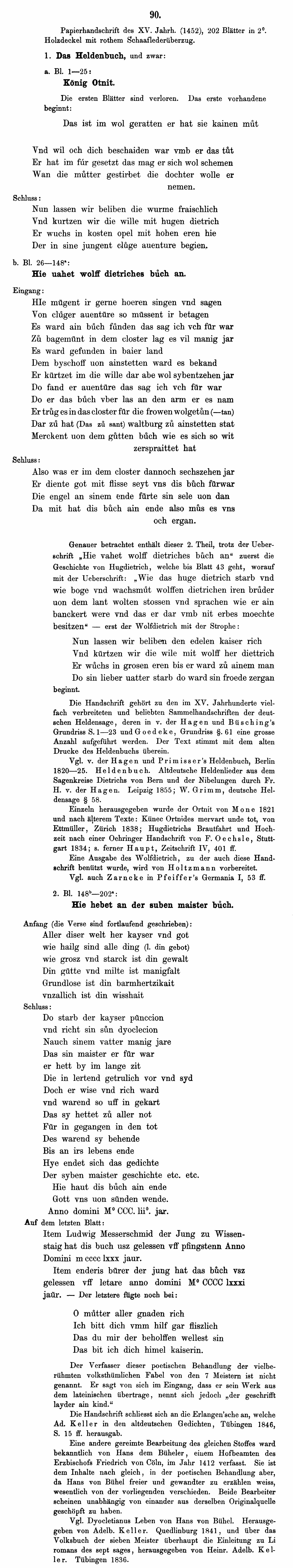
|