Barack-Nummer: 79
|
|
 Tiff-Version
Tiff-Version
|
|---|
| Überarbeiteter Text |
|---|
|
79.
[Jetzt
Karlsruhe, BLB, Don. 79]
Pergamenthandschrift
des XIV. Jahrh. (1365), 258 Blätter in gr. 2°. Holzdeckel mit weissem
Schaafleder überzogen und Metallbuckeln beschlagen. Schrift in doppelten
Spalten.
1. Bl.
1—200:
Rudolf
von Hohenems Weltchronik von der Genesis bis zu Salomons Tode, mit der
Fortsetzung eines Ungenannten bis zur Heilung Naeman des Syrers (II Regum
5,17).
Anfang
:
Rihter
got herre über alle kraft.
Vogt hymelischer herschaft. Ob allen kreften swebet din craft. Dez lobt dich alle herschaft. Vrhaber aller wisheit. Lop vnde ere si dir geseit. Got
herre wann din eines wort. Schluss :
Naaman
sprach im aber zu.
Swaz
du gebieten wilt daz dv.
Ich bite dich mit gir. Daz du einer bete günnest mir. Der erden mir zu fuern hein. Sam glich swern bürden zwein. Din kneht sol fûrbaz tun niht mer. Alsam er hat getan da her. Anno
domini M°. CCC°.LX°. quinto Illustris prin-ceps Rupertus. Comes
palatinus Juxta renum. comparauitillum librum per manus. Jo. de spira
hev minimi scriptorum.
Diese
Handschrift enthält — nach kurzem Prolog mit dem akrostichisch
angedeuteten Vornamen des Verfassers, Rudolfs von Hohenems, biblische
Erzählungen von der Genesis bis zu Salo-mon's Tode mit namhaften Episoden
aus allgemeiner Erdbeschreibung und paralleler weltlicher Geschichte, z. B. von
Blatt 12 bis 22, wo insbesondere auf Blatt 16 die ausführliche Schilderung
Deutschlands und seiner damaligen Bestandteile, Schwaben, Franken, Baiern,
Rheinland, Thüringen, Sachsen , Beachtung verdient. Die hier in ändern
Handschriften oft vorkommende Beschreibung der Städte am Rhein fehlt
indess. Vgl. Vilmar, a. a. 0. S. 32, 33 ff.
Die Widmung an den römischen König Konrad IY. findet sich vor dem Anfang des Buchs der Könige. Bl.
118a, Sp, l, Z. 17
v. u. ff.:
Min
lieber herre durch den ich.
An diz buch noch min arbeit. Mit tihten han geleit. Vnd ez mit gotes helfe wil. Für sich tihten vf daz zil. Ob mir got der iare gan. Daz ich uch moge gedienen dar an. Daz ist der kûnig Cunrat. Dez keisers kint der mir hat. Geboten vnd dez bat mich. Minneclichen daz ich. Durch in die mere dihte. Auf
Blatt 184% Sp. l bricht des Rudolf von Ems Text, der bei jenem Abschnitt vom Tod
ereilt wurde, ab mit den Versen:
Bi
Salomones zit.
Do
waz zu Rome ane strit.
Der
selbe kûnig Syluius. Von dem seit die kronike sus. Er wer an tagenden vz
erkorn. Vnd von Enea geborn.
Der
unbekannte Fortsetzer widmet dem ritterlichen Dichter im Anschluss daran
folgenden Nachruf:
Der
diz buch getihtet.
Hat.
vntz her verrihtet.
Wol an allen orten. An sinnen vnd an worten. Der starp in welschen riehen. Ich weiz wer sich im geliehen. Glichen moge an solicher meisterschaft Der mit so gantzer sinne kraft. An ein ende müge getihten. Mit kurtzen worten wol verslihten. In der geriht in der getat. Als ers an gehaben haben. Erstarp an Salomone. Got gebe im zu lone. Ein liehte kröne in himelrich. Nu vnd iemer eweclich. Sin nam ist uch wol bekant. Rudolf von ans waz er genant. Durch
Leerlassen einer Columne des Blattes ist der Ueber-gang zum Texte eines Anderen
auch äusserlich angedeutet.
Die
Fortsetzung erstreckt sich sodann, in ziemlich genauem Anschlusse an den
biblischen Text bis zur Geschichte Naeman des Syrers, wo sie
(IL Regum 5, 6) ohne förmlichen
Schluss plötzlich aufhört.
Der Text ist von vielen mit Deckfarben auf Goldgrund gemalten Miniaturgemälden begleitet, in welchen die biblischen Ereignisse
in Tracht und Waffen des XIII. und XIV. Jahrhunderts dargestellt sind.
Eine
grosse, das ganze Folioblatt füllende Malerei steht dem Gedichte
vorangeheftet. Auf derselben ist die Erdkugel dargestellt, deren Furchen der
Mensch mit einem Pfluggespann durchpflügt; rings um sie fliesst in
grünem Kreise das Meer, oben in blauem Himmelsraum thront der Heiland,
umgeben von Engel-schaaren, unterhalb in dunkelbraun rother Hölle
quälen Teufel die Seelen der Verdammten.
Eine der unsrigen nach Text und künstlerischer Ausschmückung nahe stehende Pergamenthandschrift ist die der Abtei Rheinau, deren Hagen und Büsching im Grundriss p. 243, Zapf in den Reisen in einige Klöster Schwabens p. 133ff. und Massmann, Kaiserchronik 3, 172, Nr. 14. Erwähnung thun. Bl.
200b—201 leer.
2. Bl.
202—258:
In
gotes namen amen, hie hebet an sante Eisebeten leben, etc.
Anfang
:
Gute
abenture zu sagen.
Ist gar wol zu vertragen Wann sie leret einen man. Der sich do bi gezihen kan. Daz er gewinnet reinen mût. Vnd iemer tûgentlichen tut. Dez ist ein Spiegel vns gegeben. Der
heiligen altveter leben. Schluss :
Sus
ist die frawe here.
Zu
gnaden iemer mere.
Vnd auch zu tröste wol gereit. In angest vnd in arbeit. Diesen wirdeclichen rat. Die frawe here von gote hat. Der
sie besunder eret. Mit wirdekeide heret Dem iemer me nu si gesaget. Zu lobe
siner zarten maget. Tugend gnade vnd ere. Nach hute vnd iemer mere
Amen.
Der
Schluss, eine halbe Spalte auf BI.
258a, ist ohne Linien und obwohl von
derselben Hand, doch weniger sicher, und, wie sich herausstellte,
nachträglich, nachdem das ursprüngliche letzte Blatt auf den hintern
Deckel aufgeklebt worden war, geschrieben. Die unbeschriebene untere Hälfte
des Blattes ist abgeschnitten. Sonst ist die Handschrift unversehrt,
vollständig, von derselben Hand mit grosser Deutlichkeit und
Schönheit, und wie der Schluss des nunmehr abgelösten Blattes sagt, in
demselben Jahre geschrieben, wie die vorausgehende Weltchronik. Der Schluss
lautet: “Diese zwen bücher hat erzuget der edel hochgeborne furste
hertzoge Euprecht der elter pfalntz-graue by dem Eine dez heilichen Romischen
riches oberster drochsesze vnd herzöge in beigern. Anno M. ccc°. lx.
quinto."
Dieses
werthvolle Stück hiesiger Bibliothek stammt aus dem ehemaligen Kloster
Wiesenstaig (“Ex Bibliotheca Wisensteigensi: 1626" auf Bl.
3a) und scheint, den
kalligraphischen Spielereien auf Bl.
119a zu Folge im XV. Jahrhundert im
Besitz der gräflichen Familie von Helfenstein gewesen zu sein.
Einen
Auszug aus diesem Gedichte, dessen Verfasser ohne Zweifel derselbe ist, der auch
das von K. Bartsch herausgegebene Gedicht “Die Erlösung" dichtete
(vgl. Bartsch in Pfeiffer's Germania VII, l ff.), giebt nach einer
Darmstädter Handschrift Graff's Diutiska I, 344—489.
Zum
Zweck einer Ausgabe wurde vorliegende Handschrift vor Kurzem mit dem Texte der
Darmstädter von Dr. Max Riege r verglichen. S. auch H. Kurz, Geschichte der
deutschen Literatur I, 467 u. ff.
|
| Originaltext |
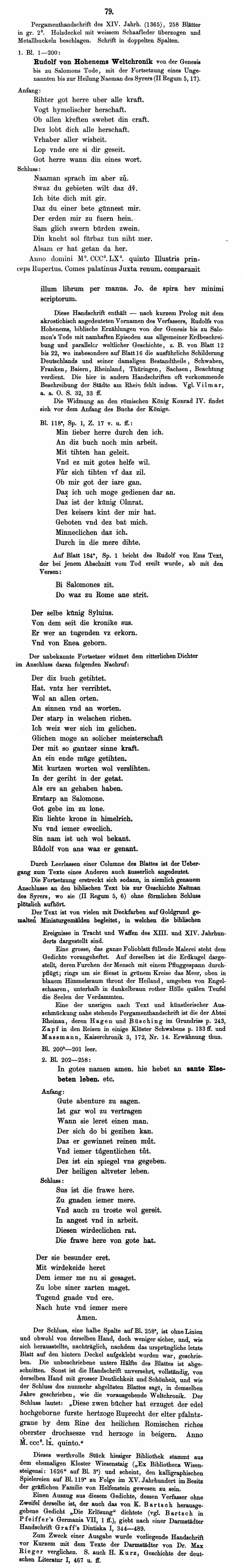
|